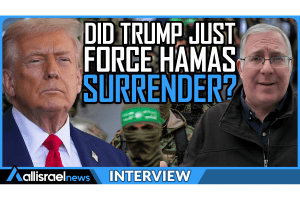Was wäre, wenn der Tempelberg das Fundament des Friedens – und nicht des Konflikts – wäre?

Blick auf den Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem, 2. April 2025. (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)
Der Tempelberg ist in Aufruhr.
In den letzten Jahren – und mit spürbarer Dynamik seit dem Krieg – haben immer mehr Juden die heiligste Stätte des Judentums, den Tempelberg, betreten. Was einst eine seltene und stark eingeschränkte Praxis war, hat sich still und leise zu einer Welle jüdischer Gebete auf dem Berg entwickelt. Dieser Anstieg wird oft als provokativ oder gefährlich dargestellt, aber was wäre, wenn er ein Zeichen der Hoffnung oder sogar der Erlösung wäre?
Die Propheten sahen den Tempelberg nicht als Brennpunkt für Konflikte, sondern als Fundament des Friedens. Wie der Prophet Jesaja verkündete: „Denn mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker.“
Heute jedoch ist der Zugang für Juden und Christen stark eingeschränkt, und muslimische Behörden üben eine unverhältnismäßige Kontrolle aus.
Wenn Israel den Berg vollständig als spirituelles Zentrum des jüdischen Lebens akzeptieren würde – und wenn Juden, Christen und Muslime dort alle frei beten dürften –, könnte dieser umkämpfte Hügel dann endlich sein altes Versprechen erfüllen? Könnte der Wiederaufbau des heiligen Ortes zum Entwurf für Frieden in der Region werden, statt zum Auslöser für Krieg?
Am vergangenen Sonntag, dem Tisha B'Av, bestiegen laut Angaben der Tempelberg-Verwaltung mehr als 3.500 Juden den Tempelberg. Dies entspricht einem Anstieg von 32 % gegenüber dem bisherigen Rekord.
Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Beyadenu ist die durchschnittliche Zahl der jüdischen Besucher pro Monat von etwa 60 im Zeitraum 2013–2014 auf heute mehr als 4.000 gestiegen. Allein in diesem Jahr sind mehr als 60.000 Juden auf den Berg gestiegen, und bis zum Jahresende wird diese Zahl voraussichtlich auf 70.000 steigen.
Im Vergleich dazu bestiegen im vergangenen Jahr nur etwa 36.000 Menschen den Berg.
„Als ich anfing, hinaufzugehen, galt das wirklich als etwas Seltsames“, sagte Rabbi Yehudah Glick, Präsident der Shalom Jerusalem Foundation, gegenüber ALL ISRAEL NEWS. „Niemand wollte hinaufgehen. Niemand hielt es für erlaubt.“
Seine Organisation und andere haben jedoch seit mindestens einem Jahrzehnt daran gearbeitet, diese Haltung zu ändern.
Ihre Bemühungen und ein allgemeiner Wandel in der israelischen Gesellschaft haben erhebliche Auswirkungen gehabt.
Zunächst einmal glaubt Glick, dass die Menschen in Israel seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober und dem anhaltenden Krieg nach etwas Größerem – etwas Spirituellem – suchen und sich deshalb dem Tempelberg zuwenden.
Während das Oberrabbinat Israels und einige ultraorthodoxe Rabbiner weiterhin daran festhalten, dass der Zutritt zum Tempelberg aufgrund von Bedenken hinsichtlich der rituellen Reinheit und der möglichen Entweihung der Stätte verboten ist, beginnen immer mehr Rabbiner – insbesondere aus der schnell wachsenden religiös-zionistischen Gemeinschaft – dies zuzulassen.
Auch politisch hat der Tempelberg zunehmend Symbolcharakter gewonnen.
Früher besuchten nur wenige extrem religiöse zionistische Abgeordnete wie der Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir die Stätte. Heute schließen sich ihnen jedoch immer mehr Politiker aus dem gesamten politischen Spektrum an.
In diesem Jahr, am Tisha B'Av – dem Gedenktag an die Zerstörung des Ersten und Zweiten Tempels – bestiegen viel mehr gemäßigte Knesset-Abgeordnete den Berg, darunter der Likud-Abgeordnete Osher Shekalim und die stellvertretende Außenministerin Sharren Haskel.
Unterdessen berichten IDF-Soldaten vom Schlachtfeld in Gaza, dass sie in vielen Haushalten der Hamas Bilder der Kuppel des Felsendoms gefunden haben. Die Hamas nannte ihren Krieg gegen Israel sogar „Operation al-Aqsa-Flut“, in Anspielung auf die al-Aqsa-Moschee, die auf dem Tempelberg steht.
„Warum hängt in jedem Haus in Gaza ein Bild des Felsendoms, und bei uns steht er nicht im Mittelpunkt?“, fragte Glick. „Das hat das Bewusstsein wirklich geschärft.“
Schließlich hat sich auch die Haltung der israelischen Polizei gegenüber jüdischen Besuchern des Tempelbergs geändert. Glick sagte, diese Änderung habe begonnen, als Gilad Erdan als Minister für öffentliche Sicherheit in der 34. Regierung tätig war. Er habe sich offen gegen die Schikanierung jüdischer Besucher durch die Waqf-Wachen und muslimische Gläubige ausgesprochen. Als diese Personen verhaftet wurden – und der Aufstieg von Juden, wenn auch nicht das offene Beten, zunehmend akzeptiert wurde –, habe sich auch die Haltung der Polizei geändert, so Glick.
Heute zeigen virale Videos in den sozialen Medien, dass Juden sichtbar anwesend sind, beten und sich sogar auf dem Berg niederwerfen, obwohl Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholt behauptet, der Status quo auf dem Tempelberg habe sich nicht geändert, und obwohl die jordanische Waqf den Ort weiterhin offiziell verwaltet.
„Die Tempelberg-Wachen, mit denen ich gesprochen habe, wollen die Juden nicht daran hindern, dies zu tun“, sagte Eliyahu Berkowitz, ein Journalist, der seit fast einem Jahrzehnt über den Tempelberg berichtet, gegenüber ALL ISRAEL NEWS. „Ich habe neulich einige Polizisten gesehen, die an einem Minjan [jüdisches Gebetsquorum] teilgenommen haben.“
Eine Umfrage des Jerusalem Institute for Strategic Studies aus dem Jahr 2017 ergab, dass 68 % der Israelis der Meinung sind, dass Juden auf dem Tempelberg beten dürfen sollten. Berkowitz sagte, dass diese Zahl wahrscheinlich noch gestiegen ist.
Glick merkte an, dass ohne die derzeitigen Beschränkungen in diesem Jahr noch mehr Menschen hinaufgestiegen wären. So lässt die Polizei beispielsweise jeweils nur etwa 70 Juden auf den Berg. Am Tisha B'Av standen viele stundenlang in der sengenden Sonne und warteten auf Einlass. Glick kam um 6:30 Uhr morgens an, durfte aber erst um 9:00 Uhr hinein.
„Das Potenzial ist viel größer“, sagte er.
Als nächsten Schritt möchte Glick erreichen, dass Juden und Christen religiöse Gegenstände wie Thora-Rollen oder Bibeln auf den Berg mitbringen dürfen. Er ist auch der Meinung, dass mehr der elf Tore zum Tempelberg für alle Besucher geöffnet werden sollten. Derzeit können Muslime durch jedes der Tore eintreten, Juden jedoch nur durch ein einziges: das Mughrabi-Tor.
Sowohl Glick als auch Berkowitz argumentierten, dass Juden ernsthaft darüber nachdenken sollten, einige Tempelrituale wiederzubeleben – noch bevor der Tempel selbst wieder aufgebaut ist. Sie verwiesen auf die jüdische Geschichte als Präzedenzfall. Als die Exilanten aus Babylon zurückkehrten, nahmen sie den Tempeldienst wieder auf, lange bevor sie über die Ressourcen oder die Erlaubnis zum Wiederaufbau des Tempels verfügten.
Heute bereiten sich einige Organisationen bereits darauf vor, diese Rituale durchzuführen und in einigen Fällen an anderen Orten zu praktizieren – nur nicht auf dem Berg.
In der heutigen Zeit mag diese Idee radikal oder sogar gefährlich klingen. Aber Berkowitz merkte an, dass er vor zehn Jahren noch mit Nein geantwortet hätte, wenn man ihn gefragt hätte, ob Juden auf dem Tempelberg beten dürften. Und doch geschieht es jetzt.
Jahrhundertelang glaubten die Juden, dass sie auf den Messias warten müssten, der sie auf „Adlerflügeln” nach Israel bringen würde. Aber die zionistische Bewegung änderte diese Denkweise und lehrte, dass die Juden ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen müssen. Glick sagte, dasselbe gelte für den Tempelberg.
„Wir sollten nicht darauf warten, dass er vom Himmel fällt”, sagte er, „sondern die Tatsache nutzen, dass er bereits in unseren Händen liegt.”
„Wir haben die Möglichkeit, hinaufzusteigen und am heiligsten Ort der Welt zu beten – dem einzigen Ort, den Hashem [Gott] erwählt hat, um seine göttliche Gegenwart zu zeigen“, sagte Glick. „Wenn man wirklich Zionist sein will, muss man Zion haben. Der Tempel ist das Zentrum Zions.“
Glick ging noch einen Schritt weiter: Jeder Staatschef, der Israel besucht, sollte den Tempelberg besuchen.
„In Amerika besuchen Diplomaten das Weiße Haus. In Paris gehen sie zum Eiffelturm. In Israel sollten sie zum Tempelberg gehen“, sagte er gegenüber ALL ISRAEL NEWS.
„Sie gehen nach Yad Vashem“, fuhr Glick fort. „Es ist, als ob unser Anspruch auf Ruhm darin besteht, dass sie uns in Gaskammern gesteckt haben – anstatt sie zum Tempelberg zu bringen, der das Herzstück unserer Nationalität, unserer Kultur, unserer Religion und unserer Identität ist.“
„Yad Vashem drückt aus, was unsere Feinde uns angetan haben“, fügte er hinzu. „Wenn Sie wissen wollen, was uns ausmacht, bringen Sie die Menschen zum Tempelberg.“
Das mag wie ein Wunschtraum klingen – oder wie ein Brennpunkt, der einen weiteren Krieg auslösen könnte, sollte dieser jemals enden. Aber die Fakten vor Ort ändern sich. Und wenn man diejenigen fragt, die heute den Berg besuchen, werden viele sagen: Es verändert sich etwas.
Nach jüdischem Glauben stand der Tempel Tausende von Jahren lang auf dem Tempelberg. Seine physische Wiederaufbau mag derzeit nicht das Ziel sein. Aber seine spirituelle Wiederherstellung – die Wiederherstellung des Berges als Ort der Einheit, Heiligkeit und des Friedens – könnte das Beste sein, was dieser Region jemals passieren könnte.
Vielleicht ist es an der Zeit, herauszufinden, ob die Propheten Recht hatten: Der Frieden beginnt wirklich auf dem Berg.
.jpg)
Maayan Hoffman ist eine erfahrene amerikanisch-israelische Journalistin. Sie ist Chefredakteurin von ILTV News und war zuvor Nachrichtenredakteurin und stellvertretende Geschäftsführerin der Zeitung The Jerusalem Post, wo sie das Portal „Christian World“ ins Leben rief. Außerdem ist sie Korrespondentin für The Media Line und Moderatorin des Podcasts „Hadassah on Call“.